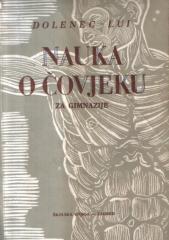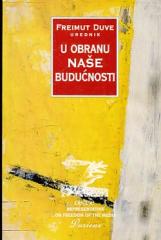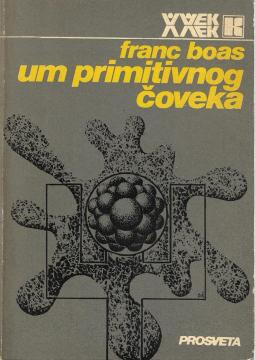
Um primitivnog čoveka
Franz Boas (1858–1942), ein deutsch-amerikanischer Anthropologe und Vater der amerikanischen Anthropologie, seziert in „The Mind of Primitive Man“ (1911) den Mythos der „primitiven“ Völker als minderwertig und propagiert den Kulturrelativismus.
Das Buch, das aus Vorlesungen an der Vanderbilt University hervorging, kritisiert rassistische Evolutionstheorien (wie die von Gobineau) und argumentiert, dass es keine biologische Hierarchie der Rassen gibt – Unterschiede seien kulturell, nicht genetisch. Boas gliedert das Werk in drei Teile: Der erste Teil untersucht die Methodik der Anthropologie und betont die Bedeutung von Feldforschung (z. B. bei den Inuit) anstelle von Spekulationen. Ein weiterer Teil analysiert die Denkweise: Die Sprachen der sogenannten „Primitiven“ (Kwakiw-Indianer) sind komplex, die Mythen tiefgründig, die Kunst anspruchsvoll – sie sind nicht „kindisch“, sondern an die Umwelt angepasst. Religion ist kein „Aberglaube“, sondern eine logische Weltanschauung. Der dritte Teil behandelt Moral und Gesellschaft: Die Ethik der „Primitiven“ ist ebenso entwickelt, aber anders; Kriege sind kulturell bedingt, nicht angeboren.
Boas’ Einfluss: Er durchbrach den Eurozentrismus, etablierte den Empirismus in der Ethnologie und inspirierte Sapir und Benedict. Das Buch, ein zentrales Werk im Kampf gegen den Kolonialismus, erinnert daran: Jede Kultur ist in sich abgeschlossen, auch ohne „Fortschritt“ – „der menschliche Geist ist überall gleichermaßen fähig“. Als Manifest des Humanismus ist es im Kampf gegen Rassismus nach wie vor relevant.
Angeboten wird ein Exemplar