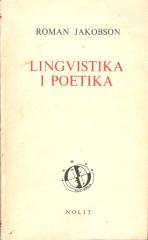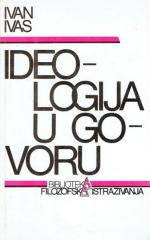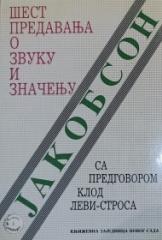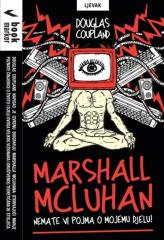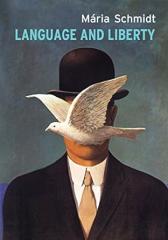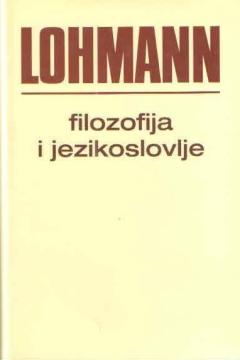
Filozofija i jezikoslovlje
Der deutsche Philosoph und Sprachwissenschaftler Johannes Lohmann entwickelte die radikale These, dass die grundlegenden philosophischen Strukturen des westlichen Denkens nicht verstanden werden können, ohne die grammatikalischen und syntaktischen Merkmal
Das Buch bzw. die Textauswahl zeigt, wie die Ontologie (Parmenides → Platon → Aristoteles → Kant → Heidegger) untrennbar mit der Sprachstruktur verbunden ist, die zwischen Substantiv (Substanz) und Verb (Prozess) unterscheidet. Der Subjekt-Prädikat-Satz des Griechischen und Lateinischen ermöglichte das „Sein“ als etwas Dauerhaftes im Gegensatz zum „Werden“. Im Gegensatz dazu kennen semitische Sprachen (Hebräisch, Arabisch) und einige asiatische Sprachstrukturen diesen scharfen Gegensatz nicht, ebenso wenig wie eine entsprechende Metaphysik der Substanz.
Lohmann argumentiert, dass die gesamte Geschichte der westlichen Philosophie „sprachlich bedingt“ sei: Die Begriffe Sein, Logos, Subjekt, transzendentales Ich und selbst Heideggers „Sein“ leiten sich von einer spezifischen indogermanischen Syntax ab. Er kritisiert Heidegger dafür, in dieser Tradition gefangen zu bleiben, anstatt sich mithilfe der Linguistik von ihr zu befreien.
Das Werk ist anspruchsvoll, aber einflussreich in den Kreisen der vergleichenden Sprachphilosophie (vgl. Humboldt, die Sapir-Whorf-Hypothese und die späteren Arbeiten von Peter Sloterdijk). Lohmann schlussfolgert, dass eine wahre „Weltphilosophie“ erst dann entstehen kann, wenn wir uns von der Illusion befreien, die griechisch-indogermanische Denkweise sei universell.
Angeboten wird ein Exemplar